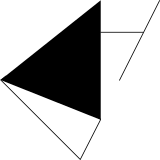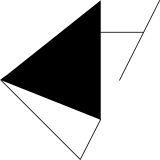Die Figur, der menschliche Körper, ist das Hauptthema des bildhauerischen und malerischen Werks des Künstlers Wilhelm Lehmbruck (1881–1919), das sowohl vom Naturalismus als auch vom Expressionismus beeinflusst ist. Lehmbruck ist mit einigen Werken in der Sammlung des Von der Heydt-Museums vertreten und findet seinen Platz im Ausstellungskonzept der Freundschaftsanfrage von Markus Karstieß. Eine der berühmtesten Skulpturen des aus Duisburg stammenden Künstlers Lehmbruck ist der sogenannte „Hagener Torso“, den er zwischen 1911 und 1912 in mehreren Varianten schuf. Das auch als „Kleiner weiblicher Torso“ benannte Werk aus der Sammlung des Von der Heydt-Museums ist das einzige Exemplar in Marmor, neben anderen Varianten aus Bronze oder Steinguss in unterschiedlichen Größen. Sie stehen für Lehmbrucks tiefgreifende Auseinandersetzung mit und seine große Sensibilität für die menschliche Gestalt. Die Figur ist bewusst als Torso, als Fragment, geschaffen worden. Lehmbruck erstellte seine ersten Torsi, als er 1910 im Alter von 29 Jahren nach Paris kam. Er nahm damit ein Thema der Antikenrezeption auf und reagierte auf ein Stilmittel, das Auguste Rodin in die moderne Bildhauerei eingeführt hatte: Die Reduktion einer Gestalt auf Rumpf und Beine setzt ihr Wesentliches, ihre Lebendigkeit frei. Das Fragment wurde zum Mittel der Vollendung. „L‘homme qui marche“ (1900) aus der Wuppertaler Sammlung ist eines der bedeutendsten Beispiele für Rodins Reduktion des Körpers auf den Torso zugunsten der Konzentration auf die Darstellung von Bewegung.
Unter Einfluss des französischen Vorbilds fand Lehmbruck zu einem eigenen plastischen Ausdruck. Die leichte Wendung des Kopfes und die geschlossenen Augen verleihen dem „Kleinen weiblichen Torso“ eine Aura beseelter Verinnerlichung. Die Proportionen des Körpers sind ausgewogen. Seine geometrisch vereinfachten Formen, die formale Reduktion und klaren Umrisslinien betonen den inneren Resonanzraum der Figur und verweisen auf deren Gefühlstiefe.
Weitere Medien
- Ort & Datierung
- 1911/1912
- Material & Technik
- Marmor
- Abmessungen
- 70 x 26 x 24 cm
- Museum
- Von der Heydt Museum
- Inventarnummer
- P 0186