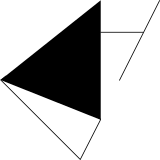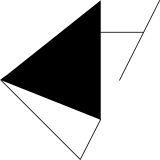Den wesentlichen Impuls für Markus Karstieß, mit dem Werkstoff Keramik zu arbeiten, gab ein Gastaufenthalt auf der Raketenstation Hombroich im Jahr 2005. Über Keramik begann Karstieß nachzudenken, als er auf das Wandrelief aus Terrakotta von Lucio Fontana aufmerksam wurde, das seit 2000 in dem eigens dafür von Erwin Heerich entworfenen Fontana-Pavillon hängt: „Il Sole“, 1952. Der italienische Künstler Fontana bearbeitete das Material sehr direkt mit Händen, Füßen oder Werkzeugen wie Stöcken. Karstieß nahm sich diese unmittelbare und körperliche Herangehensweise zum Vorbild.
Fontanas Keramikarbeiten basieren auf traditionellen Techniken und Themen, zeigen Landschaften, religiöse Szenen, Darstellungen aus der Tier- und Pflanzenwelt oder Figuren der Commedia dell’Arte. Wie in seinen bekannten „Concetto spaziali (Raumkonzepten)“ suchte er auch in seinen Keramiken die Befreiung räumlicher Begrenzung. In scheinbar spontanen, barock oder expressiv anmutenden Gesten modelliert er das Material und kommt zu bewegten Umrissen und fragmentierten Oberflächen. Im Sommer 1959 begann Lucio Fontana mit der Arbeit an einer Serie von Keramiken, die er „Nature“ nannte. Einige dieser rohen, kugelförmigen Skulpturen wurden später in Bronze gegossen. Das Von der Heydt-Museum besitzt eine Arbeit von 1960 aus der Serie „Nature“, die Karstieß für seine Freundschaftsanfrage auswählte. In den großen, vollplastischen Rundkörpern der „Nature“ drückt sich die Heftigkeit der Geste aus, der körperliche Akt, in dem Fontana sie schuf. Die Terrakottakörper wurden mit einfachsten Mitteln bearbeitet: Fontana schnitt mit Draht tiefe, lange Schnitte in die plastisch verformbare Masse, sodass diese wie eine Wunde aufklafft; oder, wie im Falle des Wuppertaler Sammlungsstücks, höhlte er sie mit den Händen oder einfachen Werkzeugen aus, um tiefe Schlunde zu erzeugen, die wirken, als seien sie in einer Explosion aufgeplatzt. Jede der großen Kugeln weist eine individuelle Gestalt auf. Mit ihnen erweiterte Fontana seine formalen Erkundungen: Ausgehend von seiner Arbeit mit Keramik in den 1930er Jahren übertrug er sein Raumkonzept auf das Medium der Bronzeskulptur.
In der klassischen Bildhauerei fungierte Keramik in der Regel als reines Modell ohne eigenes künstlerisches Recht. Fontana dagegen machte die Keramik als eigene Kunstform zum Teil seines Werks – sowohl eigenständig als auch als formgebendes Material für spätere Bronzegüsse. Obwohl der Schwerpunkt in der Rezeption des Werks Fontanas auch heute noch auf den zerschnittenen und durchlöcherten Bildern, also auf den Tagli und Buchi auf Leinwand liegt, war die Keramik von besonderer Bedeutung für die Entwicklung von Fontanas Gesamtwerk.
- Ort & Datierung
- 1960
- Material & Technik
- Bronze
- Abmessungen
- 45,5 x 54,5 cm
- Museum
- Von der Heydt Museum
- Inventarnummer
- P 0280