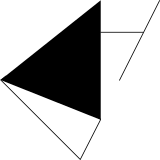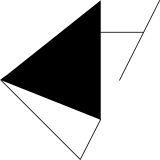Eines der ersten Sammlungswerke, das Markus Karstieß im Arbeitsprozess für sein Ausstellungskonzept der „Freundschaftsanfrage“ auswählte, war die Skulptur „Der große Verwundete“ von George Minne aus dem Jahr 1894. George Minne bildet einen Anker im Werk von Karstieß. Minnes Figuren sind oft kniend oder in einer gebeugten Haltung dargestellt und zeichnen sich durch ihre schlanken, fast asketischen Körper aus. Auch sie verkörpern meist eine Mischung aus Verletzlichkeit und innerer Stärke, die typisch für den Symbolismus ist. Dieses empfindsame männliche Körperideal hat in der Kunstgeschichte Tradition – vor allem in den 1910er/20er Jahren mit George Minne, Aristide Maillol, Georg Kolbe oder Gerhard Marcks – und erscheint als bewusste Gegenbewegung zu den heroisch-starken Männerbildern der Zeit.
Die demonstrative Wehrlosigkeit der empfindsamen männlichen Darstellungen steht dabei im Kontrast zu einer brutalen Wirklichkeit. Minnes Arbeiten entstanden in einer historischen Zeit des Aufbruchs und des Weltschmerzes um die Jahrhundertwende. Ihnen wohnt ein melancholisches Ideal der Schwäche und Verletzlichkeit inne. Die Figuren scheinen in sich versunken und ihrem Schicksal überlassen.
Das Exemplar des „Großen Verwundeten“ aus der Museumssammlung ist eine nur 40 cm hohe Bronze mit dunkler, glatter Patina: Ein Knabe steht mit gespreizten Beinen und greift mit der rechten Hand auf den Rücken, der Kopf ist schmerzvoll nach links zurückgeworfen, der linke Arm mit geballter Faust rechtwinklig gehoben. Seine Bewegungen zeugen von einem inneren Kampf, der Ausdruck der Figur ist von Schmerz verzerrt. Doch ist bis heute nicht eindeutig, wie Minnes Werke zu interpretieren sind. Handelt es sich bei den verwundeten Knaben wie in vergleichbaren Werken, um Opfer eines Krieges, einer zeithistorischen Krise oder sind es nur selbstverliebte Jungen; wie Narziss?
Fragen wie diese stellt Markus Karstieß durch kuratorische Mittel, wie halbrunde Spiegel, in denen sich die Skulpturen zeigen, sich selbst zu befragen scheinen und ihrerseits befragt werden können. Oder die Figuren müssen sich den unheimlichen Blicken von an den Wänden angebrachten Maskenreliefs von Karstieß, den Blattmasken aus Bronze mit Augen aus Freskobruchstücken, unterwerfen.
- Ort & Datierung
- 1894
- Material & Technik
- Bronze
- Abmessungen
- 39 x 20 x 11,5 cm
- Museum
- Von der Heydt Museum
- Inventarnummer
- P 0106